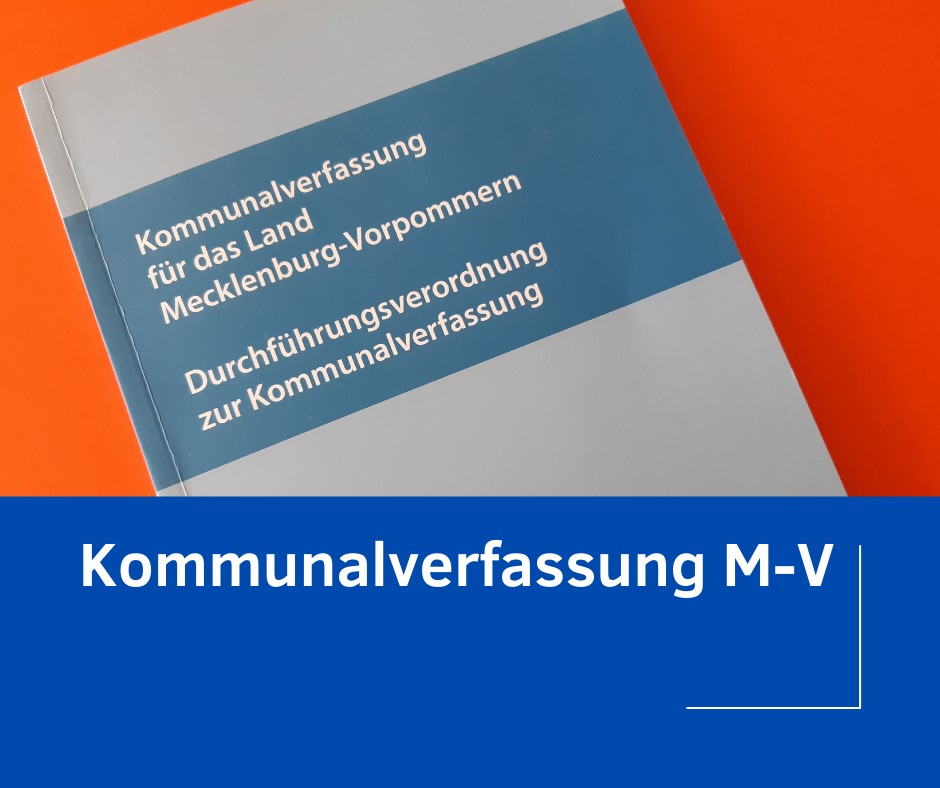Kommunale Finanzen
Finanzlage der Städte- und Gemeinden in M-V am Jahresbeginn 2024
Gute und geordnete Finanzen der Städte und Gemeinden sind kein Selbstzweck. Sie sind die Grundlage, damit die Städte und Gemeinden im Rahmen ihrer Selbstverwaltung die Daseinsvorsorgeaufgaben, die vielen wichtigen freiwilligen Aufgaben gut erfüllen können. Eine gute und intakte kommunalen Infrastruktur (z.B. Schulen, Verkehrswege, Feuerwehr, Wohn- und Gewerbegebiete, Sport- und Kultureinrichtungen, soziale Einrichtungen) macht das Leben und Arbeiten in Mecklenburg-Vorpommern attraktiv.
Auch wenn die Ergebnisse der kommunalen Jahresabschlüsse zum 31.12.2024 noch nicht vorliegen, ist nach den verbandsinternen Beratungen davon auszugehen, dass die guten, von einer aufgabengerechten, angemessenen Finanzausstattung in den Finanzausgleichsgesetzen M-V (FAG) 2020 und 2022 geprägten finanziellen Rahmenbedingungen, die auf breiter Front eine echte Haushaltskonsolidierung mit dem Abbau von Kassenkrediten und gleichzeitiger Stärkung der Investitionskraft zur Verringerung des Investitions- und Unterhaltungsstaus ermöglichten, bereits im Laufe des Jahres 2024 in vielen Städten und Gemeinden in MV vorbei waren. Vgl. im Detail die Grafiken unter https://www.stgt-mv.de/Publikationen/Infografiken/. Weiter fortwirken und weiter fortgesetzt wird die Entlastung der Städte und Gemeinden von den sog. kommunalen DDR-Wohnungsbaualtschulden, die in M-V auf ein Landesprogramm des Innenministeriums zurückgeht und aus Mitteln der Städte und Gemeinden finanziert wird. Aber bereits in 2023 und vermehrt in 2024 mussten Städte und Gemeinden die eigentlich für den Abbau des Investitions- und Unterhaltungsstaus gedachte Kommunale Infrastrukturpauschale im FAG zur Haushaltskonsolidierung einsetzen. Auch wenn diese Entwicklung in den zurückliegenden Jahresstatistiken bis 2023 noch nicht so deutlich absehbar ist, zeigt die Deckungslücke von Auszahlungen zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für alle Gemeinden und Gemeindeverbände in MV zum 30.09.2024 von -147 Mio. EUR (Vergleich 30.09.2023: -73 Mio. EUR, 30.09.2022: +157 Mio. EUR ) die sich am aktuellen Rand wieder deutlich verschärfende kommunale Finanzlage. Auch der kommunale Finanzierungssaldo lag am 30.09.2024 mit -423 Mio. EUR (Vergleich 30.09.2023: -284 Mio. EUR, 30.09.2022: -49 Mio. EUR) wieder deutlich im Minus. In den beiden Jahren davor konnten trotz Corona-Krise bedingt durch die FAG-Regelungen und die gemeinsam von den kommunalen Landesverbänden und der Landesregierung auf den Kommunalgipfeln und dem Landtag gesetzlich auf den Weg gebrachten Stabilisierungsmaßnahmen jahresbezogen Überschüsse erzielt werden, die die Kommunen zum Abbau ihrer Alt-Defizite und für Investitionen nutzen konnten. Wieder ansteigende Kassenkredite engen durch die gestiegenen Zinsen die finanziellen Handlungsmöglichkeiten in den Kommunen weiter ein.
Verantwortlich für die sich in den beiden letzten Jahren verschlechternde Finanzlage in den Städten und Gemeinden waren nicht die gemeindlichen Steuereinnahmen, die vor allem inflationsbedingt und durch die gute Beschäftigungslage stetig gestiegen sind. Die Ausgaben stiegen aber viel stärker als die Einnahmen und rissen die neuen Deckungslücken auf. Allen voran waren das die inflationsbedingten Tarifsteigerungen bei den Gehältern, die inflationsbedingten Bau- und Sachkostensteigerungen, Energiekosten und die Ausgaben für soziale Leistungen bzw. bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden entsprechend die Kreisumlagen. Durch die Verpflichtung der Kommunen, zum Schutz nachfolgender Generationen ihr Vermögen zu erhalten, können die Kommunen seit 2012 (Einführung der doppischen Haushaltsführung) anders als Bund und Länder nicht einfach ihre Haushaltsdefizite im laufenden Bereich schließen, indem sie Vermögensgegenstände veräußern oder den zeitbedingten Wertverzehr ausgleichen.
Da sich die Kommunen in MV über den Gleichmäßigkeitsgrundsatz im FAG in einer Schicksalsgemeinschaft mit dem Land bezüglich der Einnahmeentwicklung befinden, werden sich die fragwürdigen Verringerungen der amtlichen Bevölkerungszahl in MV durch den Zensus 2022, die konjunktur- und steuerrechtsbedingten Einnahmeverschlechterungen beim Land mit zeitlicher Verzögerung in geringeren Landeszuweisungen an die Kommunen im FAG niederschlagen. Für 2026 drohen den Kommunen (Stand Januar 2025) Einnahmeverringerungen aus eigenen Steuern und FAG-Zuweisungen von 270 Mio. EUR und für 2027 sogar von 388 Mio. EUR gegenüber den bis 2024 geltenden Prognosen. Wenn nicht gegengesteuert wird. Um den Kommunen auch in den kommenden Jahren eine aufgabengerechte und angemessene Finanzausstattung zur guten Erfüllung ihrer Aufgaben zu sichern und nicht nur eine Mindestfinanzausstattung („Hartz-IV für Kommunen), die sie wieder in neue und höhere Kassenkredite treibt, müssten die Finanzausgleichsregelungen für die Kommunen ab 2026 erheblich verbessert werden. Die Kommunen dürfen Gebühren und Entgelte für ihre Leistungen nur kostendeckend erheben und haben aktuell bereits vielerorts die Gebühren an die gestiegenen Kosten angepasst. Eine Erhöhung der Gewerbesteuer hat ihre natürliche Grenze in der Leistungsfähigkeit der steuerpflichtigen Betriebe und dem Wettbewerb unter den Kommunen auch über die Landesgrenzen hinaus. Die Grundsteuer zwar wichtig, vom Aufkommen mit rund 200 Mio. EUR aber zu gering, um die anderen Einnahmeverringerungen aufzufangen. Dazu kommt, dass nach dem Gleichmäßigkeitsgrundsatz im FAG nur rund 30 % der Steuererhöhungen nach der Abrechnung des kommunalen Finanzausgleichs bei den Kommunen verbleiben; kommunale Steuern im Landesschnitt also um mehr als das Dreifache des zu deckenden Finanzbedarfs angehoben werden müssten. Vor diesem Hintergrund sind Landesregierung und Landkreistag und Städte- und Gemeindetag MV am 22.11.2024 im Kommunalgespräch zu den in der Anlage aufgeführten Lösungen gekommen. Damit den Kommunen Raum bleibt, ohne neue Kassenkredite und unausgeglichene Haushalte ihre Aufgaben weiter erfüllen zu können, zu denen auch viele freiwillige soziale Aufgaben gehören wie z.B. auch die Bereitstellung von Begegnungsstätten und Gemeindezentren, sollen die überproportional gestiegenen Sozialausgaben der Kommunen reduziert bzw. gedämpft werden. Erst wenn die dadurch in 2026 erreichbaren Effekte bekannt sind, kann im Rahmen des Landeshaushaltes 2026/2027 und dem FAG 2026 entscheiden werden, wie hoch die Landeszuweisungen für eine aufgabengerechte und angemessene kommunale Finanzausstattung sein müssen.
Dokumente
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Ergebnisse des Kommunalgesprächs am 22.11.2024 | 0,43 MB |
Finanzausgleichsgesetz
Das Finanzausgleichsgesetz MV ist für 2025 mit dem Dritten Gesetz zur Anpassung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen entsprechend der Ergebnisse des Kommunalgesprächs am 22.11.2024 angepasst worden. Der Städte- und Gemeindetag hat nach Beratung im Vorstand dem Gesetz. (Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung im Bildungsausschuss des Landtages am 9.1.2025). Um auch für die Folgejahre eine angemessene aufgabengerechte Finanzausstattung der Kommunen zu gewährleisten, müssen gemeinsam von Landesregierung, Landesgesetzgeber und den Kommunen auch die weiteren am 22.11.2024 getroffenen Festlegungen realisiert werden.
FAG 2026
Bereits vor der Debatte um die Anpassung des FAG 2025 war nach den geltenden Regelungen im FAG vereinbart worden, dass die Finanzverteilung im FAG unter den Kommunen (horizontale Verteilung) in 2025 überprüft und für 2026 neu geregelt wird.
Dafür wird aktuell in enger Abstimmung mit Vertretern des Landkreistages und des Städte-und Gemeindetages ein neues Gutachten erstellt, dessen vorläufige Zwischenergebnisse voraussichtlich im März dieses Jahres vorgestellt werden. Parallel dazu führt das Innenministerium die Erhebungen zur Berechnung der Zuweisungen für die Kostenerstattung für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und der unteren staatlichen Verwaltungsbehörden für das FAG 2026 durch. Auf diesen Grundlagen soll der Entwurf des FAG 2026 erarbeitet und in 2025 vom Landtag beschlossen werden.
Zur Frage der Höhe der Finanzausgleichsmasse im FAG 2026 (vertikaler Finanzausgleich) wird der Gleichmäßigkeitsgrundsatz nach geltendem Recht überprüft. Innen- und Finanzministerium haben einen Überprüfungsbericht vorgelegt, dessen Beratung im FAG-Beirat auf Grund der bekannt gewordenen Verschiebungen im Finanzgefüge durch die unerwartet hohen Einnahmeeinbrüche im Landeshaushalt (Zensus 2022, konjunkturelle und steuerrechtsbedingte Mindereinnahmen) zunächst verschoben worden ist.
Im Vorfeld hatten sich der Landkreistag und der Städte- und Gemeindetag M-V vor dem Hintergrund der unerwarteten „tektonischen Verschiebungen“ bei den Einnahmen auf ein gemeinsames Thesenpapier zum FAG 2026 verständigt, das u.a. auf der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindetages am 6.11.2024 vorgestellt worden ist
Detaillierte Informationen zu den geltenden Regelungen im FAG, z.B. zu den Berechnungen, Auszahlungsbeträgen, Datenerhebungen und früheren Gutachten etc. sind auf der Homepage der Landesregierung zu finden (https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/Kommunales/Kommunaler-Finanzausgleich/).
Dokumente
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung im Bildungsausschuss des Landtages am 9.1.2025 | 0,23 MB | |
| Gemeinsames Thesenpapier von Landkreistag und Städte- und Gemeindetag zum FAG 2026 | 0,08 MB |
Umsetzung der Grundsteuerreform
Das Bundesverfassungsgerichts hatte entschieden, dass die Ungerechtigkeiten bei der Einheitsbewertung für die Grundsteuer ein Ende haben müssen. Die Verfassungswidrigkeit betraf die Bewertungen der Grundstücke, nicht die Art und Weise der Erhebung der Grundsteuer durch die Gemeinden auf dieser gleichheitswidrigen Bewertung durch die Finanzverwaltung der Länder. Wenn nicht bis zum 31.12.2019 eine neue gerechte Einheitsbewertung gesetzlich geregelt worden wäre, die zum 1.1.2025 auch umgesetzt sein musste, hätte die Grundsteuer in MV nicht mehr erhoben werden dürfen. Das Grundsteueraufkommen in MV beträgt 200 Mio. EUR, das sind rechnerisch im Durchschnitt ca. 125 EUR/Einwohner. Die Grundsteuern sind über Jahre sehr stabil und damit eine unverzichtbare Einnahme zur Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben.
Der Bundesgesetzgeber hatte rechtzeitig zum 31.12.2019 die rechtlichen Grundlagen zur Grundsteuerreform gelegt. Dabei hatte er den Ländern große Spielräume zur eigenen Ausgestaltung gelassen, wenn sie nicht dem neuen gerechten Bewertungsmodell des Bundes folgen wollen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat sich für die Umsetzung des Bundesmodells entschieden und war für die Umsetzung der Reform bis spätestens zum 31.12.2024 verantwortlich. Der Städte- und Gemeindetag M-V und seine Mitglieder unterstützen dabei das Ministerium im Rahmen der Möglichkeiten.
Die Finanzämter haben auf der Basis der Erklärungen der Grundstückseigentümer die Grundstücke neu bewertet und den Eigentümern Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbescheide zugesendet. Auf Basis dieser Bewertungen müssen die Städte und Gemeinden für 2025 die neuen Hebesätze für die Grundsteuern in Form einer gesonderten Hebesatzsatzung oder im Rahmen der Haushaltssatzung festsetzen und können dann nach der Multiplikation des Grundsteuermessbetrages mit dem Hebesatz die Grundsteuer 2025 erheben.
In der Praxis kommt es zu vielen Fragen, insbesondere wenn durch den aktualisierten höheren Wert nun eine höhere Grundsteuer zu zahlen ist. Die meisten Fragen betreffen die Bewertung durch das Finanzamt. Über diese kann verbindlich nur das Finanzamt entscheiden, das den Grundsteuermessbetragsbescheid erlassen hat. An den ist die Gemeinde bei der Grundsteuererhebung gebunden. Leider gehen viele Steuerpflichtige fälschlicherweise, sich damit an die Gemeinde wenden zu können, von deren Bürgermeister sie ja den Grundsteuerbescheid und die Zahlungsaufforderung erhalten haben. Dann muss die Gemeinde aber an das Finanzamt verweisen. Selbst ein unrichtiger Grundsteuermessbescheid entbindet den Grundstückseigentümer nicht von der Zahlung der Grundsteuer, wenn das Finanzamt nicht ausdrücklich diesen Grundsteuermessbescheid aufgehoben hat oder im laufenden Verfahren auf Antrag des Steuerpflichtigen eine Aussetzung der Vollziehung gewährt hat. Ein allein gegen die Bewertung gerichteter Widerspruch gegen den Grundsteuerbescheid der Gemeinde muss im Regelfall von der Gemeinde als unzulässig zurückgewiesen werden. Stellt die Gemeinde allerdings von sich aus Unrichtigkeiten und Fehler bei der Bewertung fest, kann sie die Korrektur bei Finanzamt beantragen, damit ihr keine Steuergelder verloren gehen. Aber auch dieser Antrag entbindet den Steuerpflichtigen nicht, die Grundsteuer nach dem neuen Grundsteuerbescheid erst einmal fristgerecht zu zahlen.
Die Gemeinden können, wenn sie für 2025 einen neuen Hebesatz beschlossen haben, diesen noch bis zum 30.06.2025 im Bedarfsfall erhöhen oder bis zum Ende des Jahres auch verringern. Das garantiert ihnen die grundgesetzlich abgesicherte Hebesatzautonomie. Die Gemeinden haben dabei allerdings ihre Pflicht zum Haushaltsausgleich zu beachten.
Zudem müssen die Gemeinden veröffentlichen, wie hoch die Hebesätze rechnerisch sind, mit denen sie auf der Basis der Summe der Grundsteuermessbescheide das gleiche Grundsteueraufkommen 2025 erzielen können wie 2024. Der Bund und die Länder hatten versprochen, dass die Grundsteuerreform „aufkommensneutral“ sein sollte. D.h. nur durch die Grundsteuerreform sollten Gemeinden in der Summe von allen ihren Steuerzahlern nicht mehr Geld einnehmen als vorher. D.h. dass durch die Wertveränderungen sich natürlich die Grundsteuer für das einzelne Grundsteuer auch erheblich ändern kann, um eine Gleichberechtigung wieder herzustellen.
Häufig ist die Kritik zu hören, dass bestimmte Grundstücksnutzungen nach dem neuen Recht benachteiligt werden. Dieser Eindruck kann aber auch dadurch entstehen, dass bestimmte Grundstücke in den vergangenen Jahren im Wert deutlich stärker gestiegen sind als andere. Dann ist das die Folge des Bundesverfassungsgerichtsurteils, nach dem Grundstücke gleichen aktuellen Wertes nicht regelhaft sehr unterschiedlich bewertet und in der Folge besteuert werden dürfen. Wenn das Bewertungsverfahren nach dem Bundesmodell allerdings belegbar zu Benachteiligungen bestimmter Grundstücksnutzungen führt, ist das vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt. Der Finanzminister hat erklärt, dass nach Vorlage der kompletten Daten zu prüfen und gegebenenfalls eine Änderung im Bewertungsrecht vorzuschlagen. Entscheiden kann das allerdings nur der Landes- oder der Bundesgesetzgeber.
Dokumente
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|
Kommunale Haushalte
Gute Finanzrechnungsergebnisse 2022 - Positive Einmaleffekte überstrahlen Sorgen um künftige Entwicklung
Aus den Städten und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern häufen sich die Meldungen über gute und sehr gute vorläufige Abschlüsse 2022 in der Finanzrechnung der Kernhaushalte. Diese Meldungen beruhen auf in dieser Dimension nicht vorhersehbaren positiven Einmaleffekten und dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Risiken und Herausforderungen für die Kommunalhaushalte in den nächsten Jahren unvergleichbar groß sind.
Nach den von Unsicherheiten geprägten Planungsstart und Verlauf des Jahres 2022 sind die Ergebnisse der vorläufigen Abschlüsse der Finanzrechnung der Kernhaushalte der Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern zum Jahresende mit Spannung erwartet worden. In der Geschäftsstelle häufen sich die Meldungen über gute und sehr gute vorläufige Ergebnisse. Das Geld hat 2022 gereicht.
Das ist zunächst einmal eine gute Nachricht, mit der bei Beginn der Planungen unter dem Vorzeichen der Pandemie und bei der Haushaltsdurchführung spätestens seit den Folgen des Angriffskrieges Russlands am 24.2. nicht zu rechnen war.
Allerdings ist dies zunächst nur eine vorläufige Information, die sich mit den Abschlussbuchungen noch verändern kann. Zudem ist dies nur eine Momentaufnahme zur Liquidität der städtischen und gemeindlichen Kernhaushalte am 31.12.2022, die nichts über die Entwicklung der kommunalen Vermögenslage aussagt. Dazu müssen die Daten der Ergebnisrechnungen, in denen die tatsächlichen Wertveränderungen abgebildet werden, abgewartet werden. Vieles spricht dafür, dass gerade in 2022 die Entwicklung dieser beiden in der Doppik Mecklenburg-Vorpommern abgebildeten Rechnungsperspektiven auseinandergehen. So haben sich nicht nur größere Investitionen, sondern auch Unterhaltungsarbeiten wegen Fachkräfte- und Baustoffmangel, fehlender oder verspäteter Teile, komplizierter Vergaberegeln, Fördermittelverfahren, Energie und Materialkostensteigerungen verzögert und führen dazu, dass das eingeplante Geld nicht ausgegeben werden konnte. Der dadurch erhöhten Liquidität steht die Abnahme der Vermögenswerte gegenüber.
Zu den Einmaleffekten, die die Finanzrechnungen zum 31.12.2022 verbessert haben, gehören im Wesentlichen:
- erhöhte Gewerbesteuereinnahmen
- In 2020 hatten viele Unternehmen zur Entlastung ihre Vorauszahlungen reduziert. Da die befürchteten Gewinneinbrüche ausblieben, müssen nun bei der Steuerfestsetzung für 2020 höhere Steuern abgeführt werden.
- Auch die gezahlten Corona-Hilfen an die Unternehmen müssen nun versteuert werden und erhöhen die Gewerbesteuereinnahmen.
- erhöhte Einkommensteueranteile
Auch die Einkommensteuereinnahmen liegen über den bisher erwarteten Werten, weil die Einbrüche am Arbeitsmarkt geringer ausfielen als erwartet. Statt der regelhaften Auszahlung im 3. Quartal in Höhe von 105 % des Niveaus der Vorquartale im vierten Quartal sind 125 % ausgezahlt worden.
- - erhöhte FAG-Leistungen zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen aus dem Kommunalgipfel.
Im Kommunalgipfel ist vereinbart worden, die Rückzahlung der Kommunen aus der Spitzabrechnung des FAG 2020 an das Land in Raten vorzunehmen. Dadurch war die Finanzausgleichsmasse um 100 Mio. EUR höher als bei der kompletten Rückzahlung in 2022. Die Rückzahlung der 100 Mio. EUR erfolgt in den Folgejahren.
- - erhöhte Erstattungen bei den Sozialausgaben
Im Ergebnis des Kommunalgipfels wurden die Erstattungsleistungen des Landes an die Kommunen erhöht. Die Abschlagszahlungen für die Erstattungen des AG SGB IX und XII hat das Land zeitlich vorgezogen, um die Landkreise und kreisfreien Städte bei der Liquidität zu entlasten. Die Erstattungszahlungen für den Arbeitsaufwand bei der Umsetzung des AG SGB IX wurden erhöht.
Die meisten zusätzlichen Landesleistungen erfolgten im letzten Quartal 2022, die Zahlungen auf Basis der Ergebnisse des Kommunalgipfels vom 21.11.2022 erst im Laufe des letzten Monats in 2022. Eine Umsetzung in entsprechende Auszahlungen war deshalb in 2022 kaum noch möglich.
Neben den Einmaleffekten führte der Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel zu verzögerten Stellenbe- und -nachbesetzungen sowie in der Folge geringeren Personalauszahlungen.
Die Sorge um extrem ansteigende Energiepreise führte aus Vorsicht zu einer Zurückhaltung bei den Ausgaben. Die Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung, vor allem die im November beschlossenen Strom- und Gaspreisdeckel, führen dazu, dass die extrem hohe Ausgabensteigerung und evtl. Unterstützungen von kommunalen Unternehmen aus den kommunalen Kernhaushalten 2022 vermieden werden konnten.
Gleichwohl sind die 2023 zu erwartenden finanziellen Herausforderungen für die städtischen und gemeindlichen Haushalte enorm (z.B. Inflation, Tarifsteigerungen, Einnahmeverringerung durch Steuerentlastungsgesetz, höhere Sozialausgaben und Jugendhilfeausgaben, geringere Ertragsabführungen aus kommunalen Unternehmen) und größtenteils noch nicht bezifferbar. Die unerwartet gute Liquidität zum 31.12.2022 kann helfen, diese Herausforderungen und weitere Unwägbarkeiten in 2023 abzufedern. Weitergehende aktuelle Informationen, insbesondere zum Haushaltsrecht (Doppik), zum kommunalen Finanzausgleich und zur kommunalen Haushaltskonsolidierung, enthält das Regierungsportal der Landesregierung unter dem Link https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/Kommunales.
Dokumente
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Regionalisiertes Ergebnis der Sondersteuerschätzung September 2020 | 0,06 MB | |
| Informationen des StGT zu aktuellen Daten und Fakten | ||
| Entwicklung der Gemeindesteuern | 0,16 MB |
Kreisumlage
Der Landkreis hat die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen 1. soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für die von ihm erbrachten Leistungen, 2. aus Steuern, 3. im Übrigen aus einer Kreisumlage nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern, zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. (§ 120 KV M-V).
Wie sich die tatsächlichen Kreisumlagebeträge trotz teilweiser Beibehaltung oder gar Absenkung des Kreisumlagesatzes in den vergangenen Jahren entwickelt haben, kann den Schaubildern entnommen werden, die unter der Rubrik Publikationen/Infografiken eingestellt sind. Die tatsächliche Festsetzung der Kreisumlagen ist den Kreistagen vorbehalten. Wichtig ist, dass die nach dem Ergebnis des Kommunalgesprächs am 22.11.2024 mit dem Dritten Gesetz zur Anpassung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen beschlossenen Einnahmeverbesserungen der Landkreise (Änderung des § 27 KiföG MV zu den Wohnsitzgemeindepauschalen, 5 Mio.-EUR-Entlastungsbetrag) wegen der damit verringerten Finanzbedarfe auch in Entlastungen bei den Kreisumlagen umgesetzt werden.
Bis heute warten die kreisangehörigen Städte und Gemeinden vergeblich auf die mit der Landkreisneuordnung 2012 von der Landesregierung für die Entscheidung des Gesetzgebers kalkulierten Einsparungen von jährlich über 100 Mio. EUR. Genauso unterblieben ist die mit der Umwandlung der ehemals kreisumlageunabhängigen Zuweisungen für zentrale Orte im FAG 2020 in einen kreisumlagepflichtigen Teil der Schlüsselzuweisungen („windfall-profits“) den kreisangehörigen Städten und Gemeinden versprochene schrittweise Absenkung der Kreisumlagen.
Im letzten Jahr hat die Gemeinde Perlin im Amt Lützow-Lübstorf in ihrem Klageverfahren gegen die Kreisumlage 2013 des Landkreises Nordwestmecklenburg und die zwischenzeitlich erlassene zweite Heilungssatzung aus 2020 u.a. nach zwei Berufungsverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht beim Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern gewonnen.
Wichtig ist danach, dass die Abwägungsentscheidungen der Kreistage auch die Finanzbedarfe der Gemeinden einbeziehen und gleichberechtigt berücksichtigen. Das bedeutet, dass z.B. bei der Abwägung nicht nur auf die Planzahlen des Landkreises, sondern auch auf die der Gemeinden abgestellt wird. Und soweit auf Haushaltsergebnisse der Gemeinden aus Vorjahren abgestellt wird, auch die Ergebnisse des Jahresabschlusses des Landkreises inklusive der Vorträge aus Vorjahren gegenübergestellt werden. Entscheidend ist, dass die Gemeinden, wenn sie um Stellung gebeten werden, substantiiert vortragen, wie sich ihre Haushaltslage darstellt und welche Einschränkungen bei der Aufgabenwahrnehmung oder bei den Investitions- und Unterhaltungsarbeiten bei bestimmten Kreisumlagesätzen zu erwarten sind. Erst damit können die Mitglieder in den Kreistagen konkret abwägen, welche Auswirkungen ihre Entscheidung zum Kreisumlagesatz auf die Aufgabenerfüllung der Gemeinden ihres Landkreises hat. Zur Verringerung des Finanzbedarfes des Landkreises muss der Landkreis auch seine eigenen Auszahlungen und Aufwendungen streng nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit planen und umsetzen und seine nach der Kommunalverfassung vorrangigen sonstigen Einzahlungen und Einnahmen konsequent erhaben. Dazu gehört, dass berechtigte Kostenerstattungsansprüche z.B. aus dem Konnexitätsprinzip gegenüber dem Land geltend gemacht werden (wie z.B. aus dem Gesetz zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit in den Kitas), Kostenerstattungen des Landes termingerecht verlangt werden und Ansprüche des Landes daraufhin überprüft werden, ob sie gerechtfertigt sind (z.B. Krankenhausumlagebescheide für Investitionsförderungen der Krankenhäuser aus dem Corona-Schutzfonds). Es wäre nicht zielführend, die Gemeinden über die Kreisumlage für nicht eingezogene Landeserstattungen bezahlen zu lassen.
Zur Verdeutlichung der Auswirkungen von Erhöhungen der Kreisumlagen auf die Gemeinden und die Einwohner im Landkreis könnte es anschaulich sein, die Mehraufwendungen für die Gemeinde in Hebesatzpunkte bei der Grundsteuer B umzurechnen, wenn die Gemeinde die Mehraufwendungen nicht anderweitig aufbringen kann.
Die erfolgreiche Klage der Gemeinde Perlin hat im Ergebnis aber auch die klare Grenze der Kreisumlageerhebung aufgezeigt. Eine Kreisumlage kann nicht erhoben werden, wenn dadurch die gemeindliche Mindestfinanzgarantie verletzt ist. Dies ist der Fall, wenn die Gemeinde über einen Zeitraum von z.B. zehn Jahren (Im Ergebnis der sechs vergangenen Haushaltsjahre, in der Planung im laufenden Haushaltsjahr und in den kommenden drei Haushaltsjahren) keinen Haushaltsausgleich erzielt hat und sich im Kassenkredit befand. Durch die mit dem FAG 2020 eingeführten Konsolidierungshilfen und den stärker wirkenden Steuerausgleich (Ausgleichsquote, Mindestfinanzgarantie bei den Schlüsselzuweisungen etc.). sollten genug alternative Hilfsquellen den besonders finanzschwachen Gemeinden zur Verfügung stehen. Allerdings bleibt in diesem Kontext immer noch unverständlich, warum die politische Regelung durchgesetzt wurde, dass die Entschuldungshilfen nach § 27 FAG nur für bis zum 31.12.2021 entstandene Fehlbeträge eingesetzt werden dürfen. Durch die jüngsten Entwicklungen der Landeseinnahmen und den Steigerungsraten der kommunalen Auszahlungen für gesetzlich verankerte Sozialauszahlungen haben sich die Befürchtungen des Städte- und Gemeindetages leider bewahrheitet, dass Haushaltsdefizite nach dem FAG 2022 für immer ausgeschlossen werden können.
Der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern erwartet weiterhin, dass die Gespräche mit dem Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern zu gemeinsamen Empfehlungen zum Verfahren zur Festsetzung der Kreisumlagen wieder aufgenommen werden. Die auf Basis der Rechtsprechung zur Kreisumlage von den Gremien im Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern erarbeiteten Empfehlungen zur Festsetzung der Kreisumlagen haben damit grundsätzlich weiter Bestand. Allerdings enthält auch das FAG M-V noch immer keine Regelungen zur Begrenzung der Kreisumlagen oder zur Verankerung eines landesweit einheitlichen Verfahrens zur Berücksichtigung der Auswirkungen der Kreisumlage auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden.
Dokumente
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Urteil des OVG Greifswald 2024 mit Anmerkungen der Geschäftsstelle des Städte- und Gemeindetages aus der Verbandszeitschrift "Der Überblick" | 0,27 MB |
Steuerpflichten der Gemeinden
Einführung des § 2b UStG
Die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz zur steuerlichen Neuregelung für die kommunalen Beistandsleistungen stellt viele Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern nach wie vor vor große Herausforderungen. Die Anforderungen an die Gemeinden zur Erfüllung ihrer Steuerpflichten, wenn sie sich wirtschaftlich betätigen, und die Haftungsregelungen für den Bürgermeister für nicht gezahlte Steuern sind immer weiter gestiegen. Das Kommunale Studieninstitut Mecklenburg-Vorpommern bietet hierzu Lehrgänge an. Auf Anregung des Städte- und Gemeindetages sind in die Ausbildung an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow die Grundlagen der Gemeinde als Steuerpflichtige umfassender aufgenommen worden
Die zunächst großzügig erschienene fünfjährige Übergangsfrist im Zuge der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ist nun kurz vor Jahresende 2024 zum dritten Mal um zwei Jahre bis zum Jahresende 2026 verlängert worden. Hintergrund ist, dass auch zu vielen Grundsatzfragen immer noch neue Entscheidungen vom Bundesfinanzministerium veröffentlicht werden. Auch in MV haben mehrere Städte und Gemeinden bereits umgestellt.
Dokumente
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|