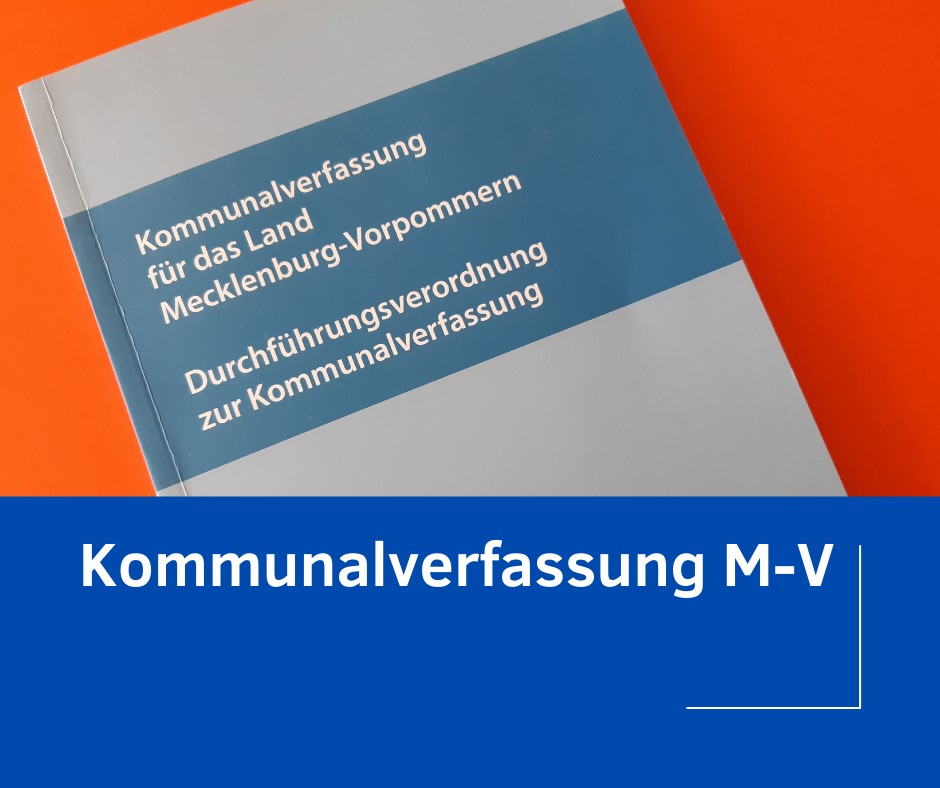Respekt und Fairness
Der NDR-Hörfunk hat am 24. Mai 2023 einen guten Beitrag „Wie können Kommunalpolitiker vor Drohungen geschützt werden?“ veröffentlicht. Nach einer aktuellen Umfrage der Körber-Stiftung hat mehr als jeder zweite Kommunalpolitiker im Norden Deutschlands angegeben, schon einmal beleidigt, bedroht oder bereits tätlich angegriffen worden zu sein.
Im Interview des ca. 9 minütigen Beitrags ist unter anderem unser Referent Klaus-Michael Glaser sowie Andreas Tebel ehemaliger Bürgermeister, der selbst massiven Bedrohungslagen ausgesetzt war. Monika Demel, ehemalige ehrenamtliche Bürgermeisterin in Altwarmbüchen und Gründerin des Vereins „Politik zum Anfassen“, der sich insbesondere um die Stärkung der Demokratie und die Beteiligung von jungen Leuten kümmert, schildert was erforderlich ist, um Demokratie vor Ort zu stärken und damit auch kommunalpolitisch Aktive vor Anfeindungen zu schützen. Ein sehr empfehlenswerter Beitrag!
Wie können Kommunalpolitiker vor Drohungen geschützt werden? (NDR.de)
Kampagne und Resolution des Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern
In den vergangenen Jahren sind in der gesamten Bundesrepublik zunehmend gezielte Anfeindungen und Anschläge gegen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker zu verzeichnen. Ursachen sind die vielfältigen und selbstverständlichen Einsätze der Mandatsträger für ein friedliches und hassfreies Miteinander vor Ort, den Erhalt unserer Demokratie oder der Flüchtlingshilfe. Unsere Demokratie lebt vom Mitmachen, davon dass sich Menschen verantwortlich fühlen, gestalten wollen und sich für Ideen einsetzen. Diese von der Bevölkerung in einem demokratischen Prozess gewählten Vertreterinnen und Vertreter, die ihre Aufgabe entweder im Haupt- oder gar im Ehrenamt ausüben, sind für die Menschen ansprechbar, für deren Probleme und auch Ideen. Streit der Meinungen gehört auch dazu, aber mit offenem Visier und Respekt - Repressalien auf offener Straße oder heimtückische Attacken verbaler oder körperlicher Gewalt eindeutig nicht!
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund berichtete im Mai gegenüber dem Handelsblatt, dass das Ansteigen der Hasskriminalität gegenüber kommunalen Amts- und Mandatsträgern besorgniserregend sei. Nach einer Studie aus diesem Jahr für das Innenministerium Brandenburg vergeht beispielsweise statistisch kein Tag, an dem es nicht irgendwo in Brandenburg zu einem Übergriff (Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschädigung oder körperliche Gewalt) gegen eine Amts- oder Mandatsperson gekommen ist. Knapp 60% der Betroffenen leiden unter psychischen und physischen Folgen aufgrund der Anfeindungen. Eine Folge kann sein, dass die Betroffenen zum Teil ihre Ämter niederlegen oder nicht wieder zur Wahl antreten. Auch in Mecklenburg-Vorpommern berichten immer mehr Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker von verbalen und sogar physischen Übergriffen. Diese Entwicklung ist dramatisch. Die Übergriffe sind ein Angriff auf unsere Demokratie. Wir brauchen eine breite Allianz zum Schutz unserer Demokratie. Es bedarf einer noch breiteren gesellschaftlichen und öffentlichen Debatte über unsere demokratische Kultur und über die Notwendigkeit und Akzeptanz vielfältiger demokratischer Meinungen. Hier sind auch die Medien in der Pflicht, nicht immer nur über negative Ereignisse zu berichten, sondern auch zu zeigen, wie gerade die vielen Ehrenamtlichen einen Großteil ihres Privatlebens für das kommunale Ehrenamt aufwenden.
Der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern möchte daher mit seiner Kampagne „Gemeinsam für mehr Fairness und Respekt in der Kommunalpolitik“ sensibilisieren, Verbundenheit signalisieren und ein Zeichen setzen, dass wir einen derartigen feindlichen Umgang miteinander vehement ablehnen und gleichzeitig für das kommunale Engagement werben, damit unsere Demokratie auch weiterhin vor Ort gelebt wird.
Daher „Gemeinsam für mehr Respekt und Fairness in der Kommunalpolitik“!!!
Weitere Informationen
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Demokratie lebt vom engagierten Gestalten der Menschen vor Ort | 0,27 MB | |
| Resolution "Respekt in der kommunalen Familie" | 0,2 MB | |
| Pressemitteilung vom 30.08.2022 | 0,3 MB | |
| Hass und Gewalt gegen Mandatsträger nimmt erschreckend zu |
Bundesprogramm „Demokratie Leben“
Unsere Demokratie muss jeden Tag neu mit Leben gefüllt werden. Sie braucht Menschen, die demokratische Kultur vor Ot leben und sie gestalten. Um diese Menschen zu stärken, gibt es das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit vielen Fördermöglichkeiten.
Hate Aid - Beratungsstelle für Betroffene digitaler Gewalt
Kommunales Engagement, also der Einsatz von Bürger*innen in ihren Städten und Gemeinden, ist ein Kern unserer Demokratie. Viele Menschen überall in Deutschland setzen sich täglich auf diese Weise ein - in Parteiverbänden, der Verwaltung, Bürger*inneninitiativen und Vereinen. Doch leider werden gerade sie immer öfter zur Zielscheibe von Hass und Gewalt. Aber Sie müssen Hass und Hetze weder akzeptieren, noch aushalten. Wehren Sie sich! Hate Aid unterstützt Sie dabei!
Beratungsnetzwerk Demokratie und Toleranz
Durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend werden in ganz Deutschland Städte, Gemeinden und Landkreise darin unterstützt, im Rahmen von lokalen Partnerschaften für Demokratie Handlungskonzepte zur Förderung von Demokratie und Vielfalt zu entwickeln und umzusetzen. Die Beratungsprojekte des Beratungsnetzwerkes arbeiten mit den Partnerschaften für Demokratie in ihren Regionen zusammen. Einen Überblick gibt es hier:
Landeszentrale für politische Bildung M-V