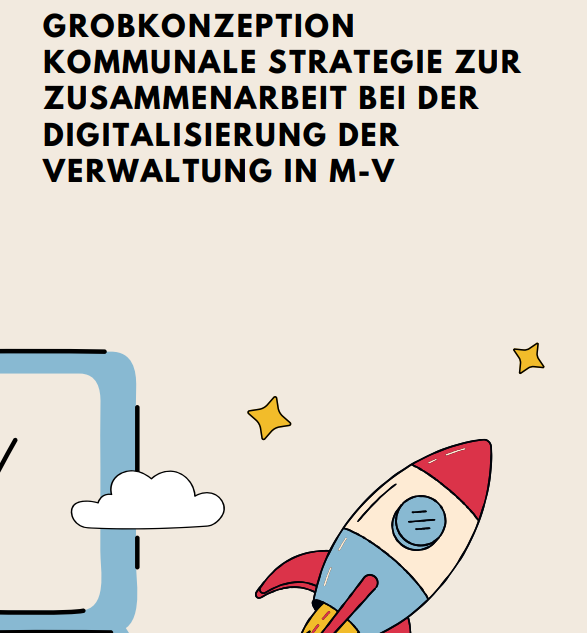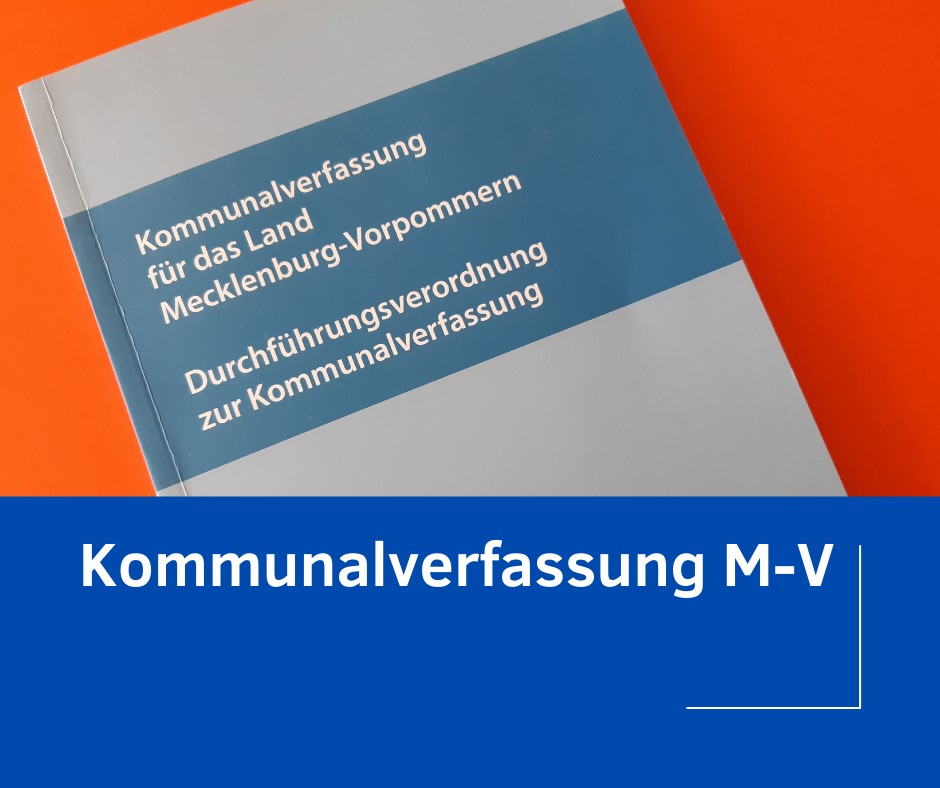Digitalisierung
Grobkonzept Kommunale Strategie zur Zusammenarbeit bei der Digitalisierung der Verwaltung in M-V
Die kommunalen Verwaltungen in unserem Land stehen insgesamt vor einem umfassenden Modernisierungsprozess. Dieser wird begleitet von Fachkräftemangel und immer knapper werdenden finanziellen Ressourcen. Gleichzeitig steigt der Kostendruck durch neue umzusetzende Aufgaben vor Ort. Trotz der stetig abnehmenden Ressourcen brauchen wir weiterhin leistungsfähige Kommunalverwaltungen.
Die zunehmende Komplexität durch steigende Anforderungen etwa im Bereich IT-Sicherheit fordert eine Zusammenarbeit auf allen Ebenen im Land. In der Vergangenheit gab es mehrere Anläufe, ein gemeinsames Vorgehen auf kommunaler Ebene zu starten und das Land hierbei mit ins Boot zu holen. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene ist bislang nicht geglückt. Zwar wurden verschiedene Strukturen, Institutionen und auch Arbeitsgemeinschaften gebildet, die ein gewisses Maß an Austausch ermöglichen, aber nicht die gemeinsame, verbindliche Zusammenarbeit fördern und der Informationsfluss oder auch Austauschmöglichkeiten sind nicht flächendeckend abgesichert.
All das in Summe führt zu Disparitäten, die die Entwicklung unseres Landes zu einem attraktiven Lebens- und Wirtschaftsstandort gefährden. Der Gedanke, enger zusammenzurücken, zusammenarbeiten, zu zentralisieren, eventuell auch über endörtlichen von Aufgaben nachzudenken ist daher ein guter und wichtiger Gedanke, dem wir im Grobkonzept „Kommunale Strategie zur Zusammenarbeit bei der Digitalisierung der Verwaltung in MV“ nachgegangen sind. Erarbeitet wurde das Grobkonzept in einer Projektgruppe, in der Vertreterinnen und Vertreter der Landeshauptstadt Schwerin, der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, des Zweckverbandes für Elektronische Verwaltung M-V, der KSM Kommunalservice Mecklenburg AöR, der IKT-Ost sowie dem Landkreistag M-V und dem Städte- und Gemeindetag M-V mitgewirkt haben.
Im März 2025 konnte das Grobkonzept Staatssekretärin Ina-Maria Ulbrich übergeben werden. Der Vorstand des Städte- und Gemeindetages hat sich im Mai zum Grobkonzept bekannt. Die Mitglieder des Zweckverbandes für Elektronische Verwaltung M-V wurden am 2. Juli 2025 über die Inhalte des Grobkonzeptes informiert. Die Landräte werden sich am 10. Juli intensiv mit dem Papier befassen. Als nächster Schritt steht die Feinarbeit als Untersetzung des Grobkonzeptes an.
Das Grobkonzept kann hier heruntergeladen werden.
Zukunftsradar 2024 - Gemeinsamer. Digitaler. Sicherer.
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund veröffentlichte am 26. März 2025 seinen Ergebnisbericht zur Kooperationsbereitschaft bei der Verwaltungsdigitalisierung. Im Ergebnis wird deutlich, dass Digitalisierung nur gemeinsam mit Kommunen, Ländern und dem Bund erfolgen kann. In Mecklenburg-Vorpommern hat sich auf kommunaler Ebene eine Projektgruppe mit genau dieser Frage beschäftigt und mögliche Zusammenarbeitsstrukturen für Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam mit dem Land entwickelt. Das Ergebnis dieses Grobkonzeptes wird aktuell beim Land geprüft und in den Verbandsgremien des Städte- und Gemeindetages als auch des Landkreistages intensiv behandelt, sodass es in den folgenden Monaten auch in diesem Heft ausführlich vorgestellt werden kann. Es zeigt jedoch, dass wir einen richtigen Weg auch in unserem Land einschlagen können. Die Pressemitteilung des DStGB vom 26. März 2025 sowie der Ergebnisbericht werden nachfolgend abgedruckt:
„Über 1.000 Kommunen senden ein klares Signal in Richtung Bund und Länder: Wenn wir die Chancen der Digitalisierung zum Wohle der Gesellschaft nutzen wollen, müssen Arbeitsstrukturen beschleunigt und verschlankt werden. Der heute veröffentlichte Zukunftsradar von DStGB und Institut für Innovation und Technik (iit) liefert aussagekräftige Daten zur Kooperationsbereitschaft der Städte und Gemeinden: 94 Prozent der befragten Kommunen würden es begrüßen, wenn eine verbindliche, föderale IT-Infrastruktur mit einheitlichen Schnittstellen und zentralen Basisdiensten zur Verfügung stehen würde.
„Städte und Gemeinden sind nicht lediglich Außenstellen von Bund und Ländern. Wenn es bei digitalen Prozessen, wie etwa bei der Kfz-Zulassung, nur darum geht, Leistungen zu erbringen, bei denen es kein Ermessen vor Ort gibt, sollten diese auch zentral von Bund und Ländern erbracht werden. Gleiches gilt für Leistungen wie Meldewesen, Wohngeld oder weitere Bundesleistungen. Wir müssen jetzt schnell ins Handeln kommen. In einem ersten Schritt sollte ein für alle Kommunen nutzbares Softwareangebot bereitgestellt werden. Die Daten aus dem Zukunftsradar unterlegen eindrücklich, dass die Kommunen startklar sind für ein dringend erforderliches Update der föderalen Kooperationen in der Digitalisierung,“ formuliert DStGB-Hauptgeschäftsführer Dr. André Berghegger.
Auch im Bereich der Cybersicherheit müssen wir unsere Strukturen überdenken und eine stärker auf Vernetzung und Zusammen-arbeit ausgerichtete Sicherheitsarchitektur etablieren. „Cybersicherheit geht nur gemeinsam. Eine immer differenziertere digitale
Bedrohungslage macht auch vor Städten und Gemeinden nicht Halt. Rund ein Viertel der Kommunen war laut Zukunftsradar in den vergangenen zwei Jahren Ziel einer Cyber-Attacke. Das dürfen wir nicht einfach so stehen lassen. Um Bürgerinnen und Bürger, unsere Demokratie und unsere Werte besser vor Spionage, Desinformation und Destabilisierung zu schützen, müssen wir in Zukunft stärker auf Zusammenarbeit setzen. Ohne substanzielle Investitionen in die IT-Infrastruktur werden wir unsere Systeme auf Dauer nicht schützen können“, sagt Dr. Werner Wilke, Geschäftsführer des Instituts für Innovation und Technik (iit) in der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH.
„Mehr Informationsaustausch, stabile Kooperationen, Standards und harmonisierte Meldeketten bei Sicherheitsvorfällen müssen Teil einer gesamtstaatlichen Strategie gegen hybride Bedrohungen sein. Der Vorstoß, die Lockerung der Schuldenbremse für sicherheitspolitische Ausgaben auch auf den Bereich Cybersicherheit auszuweiten, ist die richtige und notwendige Schlussfolgerung, um ein Mehr an Cybersicherheit auch finanziell zu hinterlegen. Daneben gehören jetzt aber auch die derzeitigen Strukturen und Zuständigkeiten auf den Prüfstand: Wir können es uns nicht länger leisten, dass zentrale Stellen auf Bundesebene, die wie Bundeswehr, Polizei, Nachrichtendienste und BSI, die alle mit Sicherheitsfragen befasst sind, nicht deutlich vernetzter agieren und reagieren. Die Kommune als kleinste Einheit im Staatsgefüge ist zwingend auf die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch mit den nationalen Akteuren angewiesen“, unterstreicht Berghegger.
Bund, Länder und Kommunen müssen technisch, organisatorisch, finanziell und personell in die Lage versetzen, sich präventiv und reaktiv auf Cyberangriffe einzustellen. Bund und Länder stehen hier in der Verantwortung für ein möglichst hohes Maß an Sicherheit auf der kommunalen Ebene zu sorgen. Dies wird aus Sicht der Kommunen aber nur unzureichend gelingen können, wenn die Kompetenzen des BSI nicht deutlich ausgeweitet werden und in seiner Funktion für ein einheitliches Mindestniveau der Cyberresilienz verantwortlich zeichnet.
„Die Schaffung von Cybersicherheit wird zusätzliche und fortlaufend steigende Kos-ten mit sich bringen. Hier besteht kein Spielraum für Abstriche oder Kompromisse. Denn Digitalisierung und Sicherheit sind von herausragender Bedeutung für einen funktionierenden, effizienten und verlässlichen Staat“, unterstreichen Berghegger und Wilke abschließend.“
Der Ergebnisbericht kann hier heruntergeladen werden.
Digitalisierung in Kommunen
Effiziente Arbeitsabläufe durch effektive Vernetzung von internen Prozessen, zeitgemäße Nutzung digitaler Ressourcen, 24/7-Bürgerservice bis hin zum Merkmal „moderner Arbeitgeber“ in Zeiten der Personalknappheit - vieles lässt sich unter dem Begriff „Digitalisierung“ fassen. Unsere Städte und Gemeinden stehen hier nicht am Anfang sondern nutzen Informationstechnologie schon lange. 2017 hat aber der Bundesgesetzgeber das Thema für sich entdeckt und den Rechtsrahmen angepasst, um einen Online-Zugang zu schaffen. Verbunden sein sollen damit die Voraussetzungen einer umfassenderen Digitalisierung von Verwaltungsabläufen und einheitlicher Standards, wobei vieles offen geblieben ist. Damit stehen unsere Städte, Gemeinden und auch Landkreise hier aufgrund der Komplexität der Aufgaben und erforderlicher Verknüpfungen auch mit übergeordneten Ebenen vor besonderen - aber dennoch lösbaren Aufgaben, wenn eine gemeinsame Strategie verfolgt und Finanzierungslasten gerecht verteilt sind. Neben den Ansprechpartnern in unserer Geschäftsstelle bietet auch der Zweckverband Elektronische Verwaltung in M-V (eGO M-V) kompetente und umfassende Begleitung bei der Umsetzung der verschiedensten Prozesse.
Als wesentlicher Meilenstein sollte hier die Umsetzung des sogenannten Onlinezugangsgesetzes sein, das Bund, Länder und Kommunen verpflichtet, bis spätestens Ende 2022 ihre Verwaltungsdienstleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten und diese miteinander zu einem Portalverbund zu verknüpfen. Inzwischen naht das Jahresende und damit auch die Umsetzungsfrist. Jetzt sind sich alle Akteure auf Bundes- und Landesebene aber einig, dass die anspruchsvollen Zeitvorgaben des Gesetzes nicht eingehalten werden. Noch lange nicht alle Dienstleistungen der Kommunen konnten an das Dienstleistungsportal des Landes M-V angeschlossen werden. Hier ist der Zweckverband aufgrund einer vertraglichen Einigung mit dem Land unterwegs, um die wesentlichen Dienstleistungen digitalisierbar zu machen und vor Ort zu helfen.
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| DStGB: Zukunftsradar Digitale Kommune Ergebnisbericht zur Umfrage 2022 | 6,1 MB | |
| https://www.ego-mv.de/ | ||
| https://www.dstgb.de/themen/digitalisierung/ |